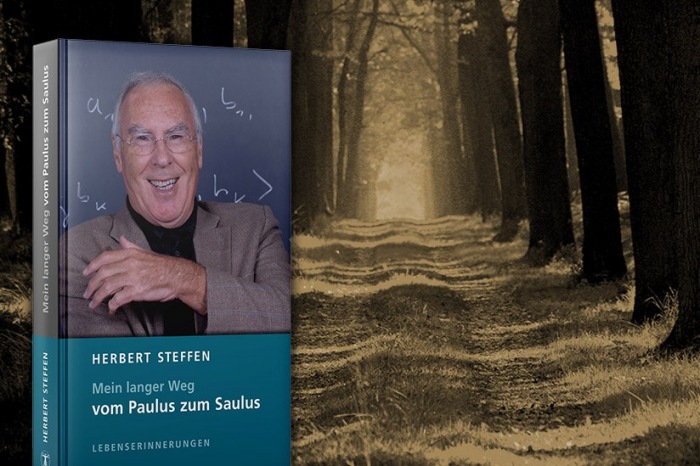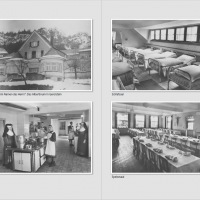gbs-Gründer Herbert Steffen veröffentlicht seine Lebenserinnerungen.
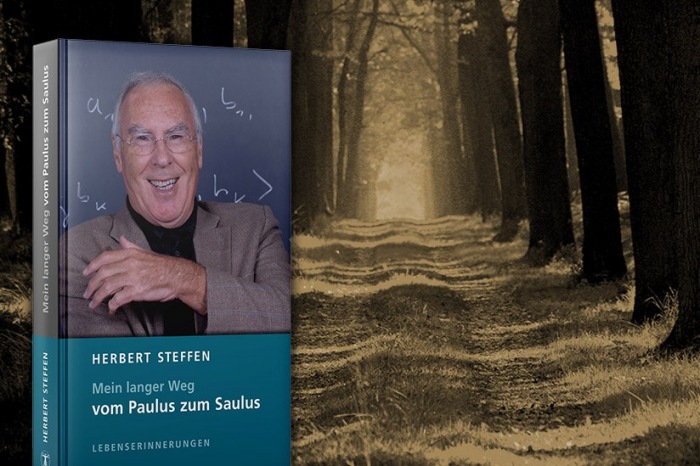
Collage von Roland Dahm (Hintergrundbild: Couleur/Pixabay)
.
Bevor er den Kirchenkritiker Karlheinz Deschner unterstützte und
die Giordano-Bruno-Stiftung gründete, war Herbert Steffen ein
strenggläubiger Katholik. In seiner gerade erschienenen Autobiografie
schildert er seinen langen Weg vom „frommen Paulus“ zum „freigeistigen
Saulus“ – die Geschichte eines Mannes, der spät, aber nicht zu spät,
„gottlos glücklich“ wurde.
„Ich stamme aus dem Mittelalter“, schreibt Steffen im Vorwort seines
Buches, „aus einem kleinen Dorf im Hunsrück, das lange Zeit keine
befestigten Straßen und keinen Strom kannte, in dem der Pastor der mit
Abstand mächtigste Mann der Gemeinde war. Die Hälfte meines Lebens war
ich gefangen in der geistigen Enge eines streng katholischen
Weltbildes.“ Anschaulich beschreibt er die kargen Verhältnisse im
Hunsrück, wo er 1934 in eine katholische Familie hineingeboren wird,
sowie seine Jahre im katholischen Internat „Albertinum“, wo er
Missbrauchsfälle beobachtet, auf die er sich aber zunächst keinen Reim
machen kann.
Nach dem Abitur will er, wie vom Vater gewünscht, Priester
werden, doch schon nach wenigen Tagen im Priesterseminar wird ihm die
Doppelmoral des Klerus bewusst, mit der er sich nicht abfinden kann:
„Ich war entweder warm oder kalt, doch niemals lau. Wenn ich von einer
Sache überzeugt war, setzte ich mich hundertprozentig für sie ein.
Dummerweise war meine ‚Herzenssache‘ damals der Katholizismus: Hätte die
Kirche von mir verlangt, einen Sprengstoffgürtel anzuziehen und die
‚Ungläubigen‘ in die Luft zu sprengen – ich fürchte, ich hätte es getan!
Deshalb kann ich gut nachvollziehen, was radikale Islamisten tun. Man
muss die religiöse Hirnwäsche selbst erlebt haben, um begreifen zu
können, was sie bei einem Menschen anrichtet.“
Vom Unternehmer zum Religionskritiker
Statt Theologie studiert Herbert Steffen Wirtschaftswissenschaften
in Köln und tritt in die Möbelfirma seines Vaters ein, die zum damaligen
Zeitpunkt rote Zahlen schreibt und von der Insolvenz bedroht ist. Es
gelingt ihm, „Steffen-Möbel“ zu retten. Unter seiner Führung wächst die
kleine Firma zu einem großen Unternehmen heran, das in den 1980er Jahren
2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. In den 1990er Jahren
jedoch gerät die deutsche Möbelindustrie durch die Globalisierung unter
Druck, die Geschäfte laufen schlechter – mit der Folge, dass Herbert
Steffen die Kontrolle über sein Unternehmen verliert, welches er wenige
Jahre zuvor an die Börse gebracht hat.
Der Verlust der Firma ist ein dramatischer Einschnitt in seinem
Leben, doch er hat bereits Jahre zuvor eine neue Lebensaufgabe gefunden,
nämlich die Religionskritik. Auslöser dafür sind zwei (umgedrehte)
„Damaskuserlebnisse“, die aus dem „gläubigen Paulus“ einen „ungläubigen
Saulus“ machen: 1973 unternimmt er eine Studienreise nach Israel und ist
schockiert über die Borniertheit seiner christlichen Mitpilgerinnen und
Mitpilger, die im vermeintlichen „Abendmahlsaal“ ergriffen auf die Knie
fallen, aber laut loslachen, als sie in der al-Aqsa-Moschee hören,
Mohammed sei von hier aus auf einem geflügelten weißen Pferd gen Himmel
aufgestiegen.
Auch das zweite „Damaskuserlebnis“ ereignet sich auf einer
Auslandsreise: 1988 liest er in einem Bungalow auf Tahiti Deschners Buch
„Abermals krähte der Hahn“: „Die Lektüre zog mich derart in ihren Bann,
dass ich für alles andere nicht mehr zu haben war. Nie zuvor in meinem
Leben hatte ich Bücher mit dieser Inbrunst gelesen, und nie zuvor hat
mich beim Lesen eine solche Wut gepackt.“
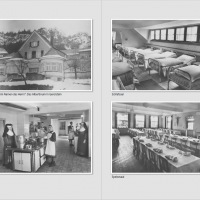
.
Vom Mäzen zum Stiftungsgründer
Nach dem Urlaub lässt Herbert Steffen nicht locker, bis er die
Adresse Deschners herausgefunden hat. Kurzentschossen fährt er nach
Haßfurt, überredet den scheuen Autor, ihn ins Haus zu lassen, und bietet
ihm seine Unterstützung als Mäzen an. Dass es Karlheinz Deschner
gelingt, seine 10-bändige „Kriminalgeschichte des Christentums“
abzuschließen, ist nicht zuletzt Steffens Verdienst. Damit Deschners
Werk nicht in Vergessenheit gerät, hat er vor, eine
Karlheinz-Deschner-Stiftung zu gründen, doch noch fehlen ihm erfahrene
Mitstreiter, um diese Idee umsetzen zu können.
Über Carsten Frerk, der im Herbst 2003 einen Vortrag über die
Finanzen und das Vermögen der Kirchen in Deutschland hält, kommt Herbert
Steffen in Kontakt zu Michael Schmidt-Salomon, der zufälligerweise
wenige Tage vor dem ersten Zusammentreffen die Druckfahnen zu seinem
Aufsatz über die Philosophie des „evolutionären Humanismus“ erhalten
hat. Steffen ist nicht nur von Schmidt-Salomon und Frerk begeistert,
sondern auch von diesem neuartigen Denkansatz, der Wissenschaft und
Philosophie, rationale Erkenntnis und humanistisches Engagement in
Einklang bringt. An der Tür verabschiedet er sich von seinen künftigen
Mitstreitern mit den Worten „Ich denke, das war heute der Beginn einer
langen und fruchtbaren Freundschaft und Zusammenarbeit!“ Auf der
Gegenseite sorgt dies allerdings für Verwunderung, wie Steffen schreibt:
„Nach Michaels Gesichtsausdruck zu urteilen, dachte er wohl, ich hätte
eine Meise!“
Wenige Tage später sprechen die beiden aber schon über die Gründung
einer Stiftung. Schweren Herzens muss Steffen dabei die Idee einer
Deschner-Stiftung aufgeben, da sich diese allein auf Kirchen- und
Christentumskritik hätte konzentrieren müssen. „Giordano-Bruno-Stiftung“
ist der bessere Name für eine Organisation, die sich einem breiten
Themenspektrum widmen soll. Nach anfänglicher Enttäuschung sieht dies
selbst Karlheinz Deschner ein – die Schilderung des heiklen Gesprächs
zwischen Deschner und Schmidt-Salomon zählt sicherlich zu den
Höhepunkten des Buches. Herbert Steffen notiert dazu: „Ich war
erleichtert, dass Karlheinz die Nachricht vom Ende der Idee einer
Deschner-Stiftung so gut verkraftet hatte und dass sich meine beiden
‚Hausphilosophen‘ trotz der schwierigen Anfangsbedingungen so gut
verstanden. Vor allem aber freute ich mich, dass es nun schon bald mit
der Giordano-Bruno-Stiftung losgehen konnte, die mein Leben in den
kommenden Jahren in völlig neue Bahnen lenken sollte…“
„Die beste Entscheidung meines Lebens“
Nur wenige Wochen nach dem Gespräch in Haßfurt, im März 2004, findet
im neu errichteten gbs-Forum in Mastershausen die erste
gbs-Veranstaltung statt: Der international anerkannte Evolutionsbiologe
Prof. Dr. Franz M. Wuketits spricht vor rund 70 Gästen über ein Thema,
das aufs Engste mit der Philosophie des evolutionären Humanismus
verknüpft ist: „Der Affe in uns: Warum eine Entzauberung des Menschen
überfällig ist“. Die Wahl des Referenten ist kein Zufall, denn Franz M.
Wuketits ist von Beginn an in die Pläne zur Gründung der gbs
eingeweiht. Durch ihn kommt die Stiftung in Kontakt zu vielen anderen
hochkarätigen Wissenschaftlern.
Steffen schreibt über Wuketits: „Manfred, wie ihn seine Freunde (zu
denen ich mich bald zählen durfte) nannten, war ein wunderbarer, aber
auch ein merkwürdiger Mensch. So richtig in die Gänge kam er erst in den
Abendstunden, dann aber hörte er gar nicht mehr auf, über Gott und die
Welt in seinem breiten wienerischen Dialekt zu diskutieren. Legendär
waren die Gespräche mit Michael in unserer damaligen Stiftungsbar, die
oft bis in die Morgenstunden dauerten und mit dem Konsum von reichlich
Alkohol und Zigaretten einhergingen. (…) Aus Versehen leerten die beiden
einmal in der Nacht meinen Geburtsjahrs-Portwein aus dem Jahr 1934! Am
nächsten Morgen war Manfreds Gesicht so zerknittert, dass ich den großen
Gelehrten kaum noch wiedererkannte.“
Anekdoten wie diese machen den besonderen Reiz des Buches aus. In
seiner „kurzen Geschichte der Giordano-Bruno-Stiftung“ plaudert Herbert
Steffen „frei aus dem Nähkästchen“ und verrät viele Hintergründe, die
selbst Insidern der Stiftung nicht bekannt sein dürften. Aber natürlich
berichtet er auch über die vielen Höhepunkte der Stiftungsgeschichte,
etwa über die diversen Kampagnen zur Sterbehilfe, zum politischen Islam,
zu Tierrechten, zum kirchlichen Missbrauchsskandal, zur Trennung von
Staat und Kirche, zu den Menschenrechten, zur Knabenbeschneidung oder
zur Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Gegen Ende des
Buchs resümiert Steffen: „Die Gründung der Giordano-Bruno-Stiftung (…)
war die beste Entscheidung meines Lebens! Denn durch die Stiftung habe
ich so viel Neues erfahren und so viele hochinteressante Menschen
kennengelernt, die ich ansonsten niemals getroffen hätte. Es stimmt
schon, was ich vor einigen Jahren gesagt habe: ‚Ich verdanke der
Giordano-Bruno-Stiftung weit mehr, als sie mir verdankt!‘“
Dabei macht der Autor klar, dass der Erfolg der gbs „ganz gewiss
nicht allein auf meinem oder Michaels Mist gewachsen“ ist, sondern dass
daran unzählige andere Menschen beteiligt waren. Namentlich listet er im
Buch rund 250 Personen auf, ohne die die gbs nicht zu dem geworden
wäre, was sie heute ist, nämlich, wie es der „Spiegel“ einmal
formulierte, „das geistige Oberhaupt all derjenigen, die geistigen
Oberhäuptern nicht trauen.“
Die Autobiografie „Mein langer Weg vom Paulus zum Saulus“
kann ab sofort als pdf-Dokument kostenfrei von der gbs-Website
heruntergeladen werden. Mitglieder des gbs-Beirats und des
gbs-Stifterkreises sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung
und der aus ihr hervorgegangenen Organisationen erhalten das Buch zudem
in gedruckter Form. Im regulären Buchhandel wird die Autobiografie auf
absehbare Zeit nicht erhältlich sein.
.